Die Protagonisten aus Am Horizont der Sonne und das individuelle Schicksal historischer Persönlichkeiten – jenseits der Romanhandlung.
Mein Historienroman Am Horizont der Sonne ist reich an Charakteren – sowohl historisch verbürgte Persönlichkeiten als auch fiktive Figuren, die sich nahtlos in das Geschehen einfügen.
Um meinen Leserinnen und Lesern einen besseren Überblick zu ermöglichen und den Zugang zur Geschichte zu erleichtern, habe ich diese Übersicht erstellt: Ein Leitfaden durch die Handlung, der jederzeit nachschlagen lässt, wer welche Rolle spielt, welche Beziehungen bestehen und welche Entwicklungen sich entfalten.
So wird das Leseerlebnis intensiver, ohne dass man sich in der Fülle der Namen, Figuren und Ereignisse verliert.
Die zentralen Schauplätze meines Romans sind: Uaset (Theben) – das heutige Luxor, und Achet-Aton (Horizont der Sonne) – das heutige Tell el-Amarna.
Die Pharaonen in der Reihenfolge ihrer Regierung, ihre Gattinnen und Kinder
Amenhotep und Teje
Pharao Amenhotep III. – ein Schatten in Am Horizont der Sonne
Pharao Amenhotep III., Gemahl der berühmten Königin Teje und Vater des späteren Echnaton, regierte Ägypten über vierzig Jahre lang. Seine letzte Ruhestätte fand er in WV22, einem abgelegenen Seitental westlich des Tals der Könige.
Die Mumie des Pharaos wurde 1898 von Victor Loret entdeckt – kurioserweise im Sarg seines Großvaters, mit einem Deckel, der ursprünglich zu Sethos gehörte.
Teje, die Mutter Echnatons, wurde in Grab KV35 aufgefunden, gemeinsam mit Kija, die zu Lebzeiten grausam entstellt wurde und als mögliche Mutter von Tutanchamun gilt. Heute ruht Tejes Mumie im Mumiensaal des National Museum of Egyptian Civilization (NMEC) in Kairo.
In meinem historischen Roman Am Horizont der Sonne tritt Amenhotep III. nur am Rande auf. Er erscheint vor allem in Erinnerungen – als Echo einer vergangenen Epoche, die dennoch das Schicksal meiner Figuren prägt.
Kolossalstatue des Königspaares Amenhotep III. und Teje, ausgestellt im Ägyptischen Museum in Kairo.
Die monumentale Darstellung zeugt von königlicher Nähe und der besonderen Stellung Tejes als Große Königliche Gemahlin.
Echnaton und seine Familie – Spuren im Sand der Geschichte
Von Echnaton und seiner Familie fehlt – mit Ausnahme von Tutanchamun – nahezu jede Spur. Echnaton gilt als gesicherter Vater des jungen Pharaos, doch die Damnatio memoriae hat tiefe Spuren hinterlassen: Von Nofretete existieren keine gesicherten Lebenszeichen mehr. Ihre Darstellungen wurden ihrer Identität beraubt – Namen und Attribute abgeschlagen oder durch jene von Kija oder Meritaton ersetzt.
Maketaton, die zweitälteste Tochter des Königspaares, starb vermutlich im Alter von etwa zehn Jahren. Eine Wandmalerei im Königsgrab von Amarna zeigt Echnaton und Nofretete in tiefer Trauer – ihr Tod könnte auf Komplikationen im Kindbett zurückzuführen sein.
Die drei zuletzt geborenen Töchter des Königspaares werden in den Aufzeichnungen kaum erwähnt. Es ist anzunehmen, dass sie bereits im Kleinkindalter verstarben – ein tragisches Schicksal, das sich im Schweigen der Quellen widerspiegelt.

Zerschlagene Kolossalstatue des Königs und die Kompositbüste der Nofretete aus der Werkstatt des Tutmosis (Djehutimes), ausgestellt im Ägyptischen Museum in Kairo. An Nofretetes wohlgeformtem Gesicht sind die feinen Hilfslinien des Künstlers deutlich erkennbar. Ihr Kopf, bereits mit den Konturen einer Kappe bemalt, endet in einem Zapfen – einst gedacht zur Befestigung einer individuellen Kopfbedeckung. In der Regel trug Nofretete ihre ikonische blaue Krone.


Semenchkare und Meritaton – Schattenfiguren der Amarna-Zeit
Meritaton, die älteste Tochter von Echnaton und Nofretete, verbindet eine rätselhafte Beziehung mit Semenchkare – einem jungen Mann, dessen Herkunft bis heute im Dunkeln liegt. In den historischen Quellen erscheint er zunächst als Mitregent und übernimmt für kurze Zeit die Nachfolge Echnatons.
Die Mumie, die in Grab KV55 entdeckt wurde – umgeben von zahlreichen Grabbeigaben und einem beschädigten Sarg – wurde im Laufe der Jahre verschiedenen Personen zugeschrieben: Echnaton, Nofretete und dem geheimnisvollen Semenchkare, dessen Geschlecht nicht einmal eindeutig geklärt ist.
In meinem Roman ist Semenchkare ein junger Mann mit stiller Tiefe. Eine Szene zeigt ihn auf dem Weg zum Thronsaal, um Echnaton um Meritatons Hand zu bitten. Von der „Brücke der Erscheinung“ blickt er wehmütig auf die Stadt hinab – und erinnert sich an die unbeschwerten Tage seiner Kindheit.
Diese literarische Interpretation verwebt historische Rätsel mit emotionaler Fiktion – und lädt dazu ein, die Amarna-Zeit durch die Augen derer zu erleben, die zwischen Licht und Schatten wandelten.


Dieses kleine Relief, ausgestellt im Neuen Museum Berlin, wird oft als „Spaziergang im Garten“ bezeichnet. Es zeigt ein königliches Paar in inniger Zweisamkeit – meist als Semenchkare und Meritaton gedeutet. Manche vermuten jedoch Tutanchamun und Anchesenamun, da der junge Mann sich auf einen Stock stützt – ein Detail, das an die zahlreichen Spazierstöcke erinnert, die in Tuts Grab gefunden wurden.
Der zerstörte Sarkophagdeckel aus KV55 im Ägyptischen Museum in Kairo
Tut-Ench-Aton und Anchesenpaaton – Kinderehe unter dem Schatten des Umbruchs
Anchesenpaaton, die dritte Tochter von Echnaton und Nofretete, war etwa zwei Jahre älter als ihr Stiefbruder Tut-Ench-Aton. Nach dem Tod ihres Vaters wurden die damals 9- und 11-jährigen Kinder miteinander vermählt. In diesem Zuge wurde der Name „Aton“ aus ihren Namen getilgt und durch „Amun“ ersetzt – ein symbolischer Bruch mit der religiösen Reform ihres Vaters.
Die Vormundschaft über den jungen Pharao übernahmen faktisch Eje und Haremhab, zwei einflussreiche Männer am Hof. Die Ehe blieb kinderlos, abgesehen von zwei dokumentierten Totgeburten, und endete mit dem frühen Tod Tutanchamuns im Alter von etwa 18 oder 19 Jahren.
Tutanchamuns Mutter war vermutlich Kija, eine enge Verwandte Echnatons – möglicherweise sogar seine Schwester. Tutanchamun selbst zählt zu den bekanntesten Pharaonen des alten Ägypten, da sein Grab KV62 als einziges nahezu unversehrtes Pharaonengrab aus jener Zeit gilt. Seine Mumie ruht bis heute in einem gläsernen Sarg in KV62 und soll nach Fertigstellung des Grand Egyptian Museum (GEM) dorthin überführt werden.
Von Anchesenamun weiß man nur wenig. Ein kleiner, zierlicher Ring bezeugt ihre spätere Heirat mit dem greisen Eje – kurz nach Tutanchamuns Tod. Diese Inschrift gilt als ihr letztes Lebenszeichen.
Dieses zauberhafte Bild gestaltete ich nach der weltberühmten Szene auf der Rückenlehne von Tut-Ench-Amuns Thronsessel
Die kunstvoll verzierte Rückenlehne von Tutanchamuns Thronsessel zeigt den jungen König in inniger Zweisamkeit mit Anchesenamun. Das Relief ist reich an Symbolik: Sonnenscheiben, Hieroglyphen und zarte Gesten erzählen von Nähe, Macht und göttlichem Schutz. Ein Meisterwerk höfischer Intimität aus der Amarna-Zeit.


Darstellung von Tutanchamun als Gott Chons im NMEC (National Museum of Egyptian Civilization). In seinen Händen hält er die traditionellen Herrschaftsinsignien Heqa (Krummstab) und Nechacha (Geißel). Die charakteristische Jugendlocke verweist auf seine Rolle als junger König und göttlicher Sohn.
Eje und Tie – Macht, Mythen und familiäre Rätsel
Der etwa siebzigjährige, verwitwete Eje heiratete Anchesenamun, um seinen Anspruch auf den Thron zu legitimieren. In großer Eile ließ er das Grab Tutanchamuns vollenden und inszenierte sich dort – bei der sogenannten Mundöffnungszeremonie – als dessen Nachfolger. Seine Regierungszeit dauerte vier Jahre.
Ejes Grab befindet sich in WV23 (auch KV23 genannt) und trägt wegen seiner auffälligen Wanddekoration den Beinamen „Affengrab“. Der Verbleib seiner Mumie ist bis heute ungeklärt – ein weiteres Rätsel der Amarna-Zeit.
Tie wird häufig als Amme der Nofretete erwähnt. Frühere genealogische Spekulationen gingen davon aus, dass Eje und Teje die Kinder von Tuja und Juja gewesen seien – den Eltern Tejes. In dieser Theorie wären Nofretete und Mutnedjemet wiederum die Töchter von Eje und Tie gewesen. Diese familiäre Konstruktion gilt heute jedoch als überholt und wird von der Forschung nicht mehr gestützt.
Haremhab und Mutnedjemet – Aufstieg eines Soldaten-Pharaos
Haremhab folgte Eje auf den Thron und gilt als erster Vertreter der sogenannten Soldaten-Pharaonen. Als oberster Heerführer trug er laut historischen Quellen den Titel „Stellvertreter des Königs an der Spitze der Beiden Länder“ und bekleidete zahlreiche zentrale Ämter: Oberbefehlshaber des Heeres, „oberster Mund des Landes“, Erbfürst (Iripat) sowie Obervermögensverwalter.
Vermutlich besaß Haremhab ein Grab in Amarna sowie ein weiteres in Sakkara, wo seine zweite Frau Mutnedjemet im Grab seiner ersten Gemahlin Amenia beigesetzt wurde. Sein offizielles Königsgrab, KV57 im Tal der Könige, wurde geplündert – der Verbleib seiner Mumie bleibt bis heute ungeklärt. Auch von Mutnedjemet fehlt jede Spur.
Diese Figuren markieren den Übergang von der Amarna-Zeit zur Restaurierung traditioneller Machtstrukturen – ein spannender Abschnitt, der in meinem Roman zwischen Licht und Schatten erzählt wird.
Eje, rechts im Bild mit dem charakteristischen Pantherfell, vollzieht die Mundöffnungzeremonie (Wepet-Ra) im Grab des Tutanchamun. Vor ihm steht der zum Osiris gewordene König. In den Händen hält Eje den Mesechtiu, den rituellen Dechsel. Vor seinem Gesicht sind bereits seine Namen in einer königlichen Kartusche zu lesen – darunter auch „It Netjer Ai“, der Titel „Gottesvater Eje“.
Ramses und Sethos – Soldaten, Schatten und eine Mumie auf Irrwegen
Ramses I., Vater von Sethos I., setzte die Tradition der Soldaten-Pharaonen fort, die sein kinderloser Ziehvater und Förderer Haremhab begründet hatte. Seine Mumie erlebte eine außergewöhnliche Odyssee: Nach ihrer Entdeckung in der Cachette von Deir el-Bahari wurde sie von den Rassuls verkauft und gelangte über Umwege nach Amerika. Dort wurde sie im Niagara Falls Museum jahrzehntelang als makabres Schaustück präsentiert – bis sie im Jahr 2003 endlich an den Nil zurückkehrte.
Eine abschließende DNA-Untersuchung zur Bestätigung ihrer Identität steht bis heute aus – ein weiteres Rätsel in der langen Geschichte ägyptischer Mumienfunde.
Die Mumie von Sethos I., dem Vater von Ramses II., ruht heute neben der seines berühmten Sohnes im Mumiensaal des National Museum of Egyptian Civilization (NMEC) in Kairo – ein stilles Zeugnis einer Dynastie, die aus dem Schatten des Krieges hervorging und das Neue Reich prägte.
Die Nebenfiguren
Zannanza, Chattu-Zittisch und Tutmosis – Diplomatie, Intrige und Kunst in der Amarna-Zeit
Zannanza, Prinz der Hethiter und Sohn des mächtigen Königs Schuppiluliumas, starb unter ungeklärten Umständen auf dem Weg nach Ägypten. Dort sollte er – auf Wunsch der ägyptischen Königin – heiraten und als König regieren. Der Heiratswunsch basierte auf einem Brief, in dem um einen Prinzen gebeten wurde. Die sogenannte Dachamunzu-Affäre bleibt bis heute rätselhaft, denn die Briefe sind lediglich mit „Frau des Königs“ (Ta Hemet Nesu) unterzeichnet. Ob sie von Anchesenamun oder ihrer Mutter Nofretete stammen, ist bis heute ungeklärt. Die Anrede/Unterschrift Dachamunzu scheint ein Übersetzungsfehler und/oder eine Verwechslung zu sein. Das Wort gibt lautmalerisch ungefähr Ta Hemet Nesu, Die Gemahlin des Königs wider.
Chattu-Zittisch, ein Vertrauter Schuppiluliumas und sein Kämmerer, wurde zunächst ausgesandt, um zu prüfen, ob Echnaton tatsächlich verstorben war – oder ob die Bitte um einen Prinzen eine Falle darstellte. Ein zweiter Brief betonte die Dringlichkeit der Lage, und Chattu-Zittisch erkannte die echte Not der ägyptischen Königin. Daraufhin entsandte sein König Zannanza – dessen plötzlicher Tod auf der Reise die ohnehin fragilen Beziehungen zwischen Chatti und Ägypten eskalieren ließ. Die Hethiter drohten mit Krieg, denn der Verlust eines Königssohnes konnte nicht hingenommen werden.
Tutmosis (Djehutimes) hingegen steht für die künstlerische Blüte der Amarna-Zeit. Als Schöpfer der weltberühmten Büste der Nofretete ist er bis heute bekannt. Doch seine Werkstatt in Amarna hinterließ weit mehr als dieses ikonische Meisterwerk: Zahlreiche realistische Porträts und Skulpturen, die heute u. a. im Neuen Museum in Berlin zu bestaunen sind, zeugen von einer Epoche, in der Kunst, Politik und persönliche Schicksale eng miteinander verwoben waren.
Im Hintergrund des Bildes zeigt sich die Umgebung von Amarna – das historische Achet-Aton, der Horizont der Sonne, wo Tutmosis seine Werkstatt unterhielt.
Arnuwanda – ein König zwischen Feldzug und Fieber
Arnuwanda, Sohn des hethitischen Großkönigs Schuppiluliuma I., führte mehrere Feldzüge nach Syrien, bei denen seine Generäle bis auf ägyptisches Territorium vordrangen. Doch anders als in meiner literarischen Darstellung griff Arnuwanda Ägypten selbst nie direkt an – ein künstlerischer Freiraum, den ich mir in meinen Romanen bewusst genommen habe.
Sein Leben endete früh und tragisch: Arnuwanda starb an den Folgen einer Seuche, die vermutlich im Zuge der militärischen Expansion eingeschleppt wurde – ein Schicksal, das auch andere Herrscher der späten Bronzezeit ereilte. Nach seinem Tod folgte ihm sein Bruder Muršili II. als Großkönig auf den hethitischen Thron.
Arnuwanda bleibt eine historische Figur zwischen Machtanspruch und Verletzlichkeit – und in meinen Geschichten ein Symbol für die fragile Balance zwischen Krieg und Menschlichkeit.
Fiktive Nebenfiguren
Kija, Mau und Sobek – temperamentvolle Zwillinge und ein besonnener Ruhepol
Sie sind wild, temperamentvoll und herrlich ausgeflippt: Kija und Mau, die fiktiven Zwillings-Töchter von Tutanchamun und Anchesenamun, bringen jede Szene zum Lodern. Ihre Energie sprengt die Grenzen höfischer Etikette – sie lachen laut, streiten leidenschaftlich und lieben kompromisslos.
Und mittendrin: Sobek, der Sohn von Setepenre und dem erfundenen Tutmosis. Er ist der Ruhepol, der Vermittler, derjenige, der all das aushalten muss – und es mit stoischer Gelassenheit tut. Sobek wird später Kijas Gatte, und ihre Verbindung ist alles andere als gewöhnlich: eine mythische Liebesgeschichte, geboren aus Chaos und Tiefe.
Diese Nebenfiguren sind keine Randnotizen – sie sind emotionale Farbkleckse in der Welt meiner Romane. Sie zeigen, dass auch im Schatten der großen Namen wie Echnaton, Nofretete oder Ramses Platz ist für Herz, Humor und Rebellion.
Mentuhotep, Tetitschere, Ahmose und Neferhotep – Heiler, Freunde und stille Tragödien
Mentuhotep und sein Vater Neferhotep gewähren einen Einblick in das Leben eines Arztes im alten Ägypten – ein Beruf, der nicht nur hochangesehen war, sondern auch tiefes Vertrauen und Verantwortung bedeutete. Mit klarem Verstand und warmem Herzen begleiten sie die Figuren meiner Romane durch Krankheit, Zweifel und innere Wandlung.
Mentuhotep wird zum väterlichen Freund Tutanchamuns – ein ruhender Pol, ein Vertrauter, der dem jungen Pharao Halt gibt in einer Welt voller Machtspiele und Unsicherheit. Ein stiller Begleiter, der mehr sieht, als er sagt – und dessen Weisheit weit über medizinisches Wissen hinausreicht.
Tetitschere trägt ein Schicksal, das sich nicht in Worte fassen lässt. Ihr Weg ist kein Pfad, sondern ein Abgrund – und doch geht sie ihn mit einer Würde, die den Leser berührt, ohne alles zu offenbaren. Sie steht für jene Stimmen, die in der Geschichte oft überhört werden – und für die Kraft, die im Schweigen liegt.
Ahmose, Tutanchamuns Gefährte, bringt Licht und Leichtigkeit in die Erzählung. Gemeinsam erleben sie ein Abenteuer, das alles verändert – und dessen Ausgang tief unter die Haut geht. Was geschieht, bleibt verborgen, doch seine Rolle ist entscheidend für das, was folgt.
Diese Figuren sind keine Randnotizen – sie sind emotionale Anker, stille Helden und lebendige Spiegel einer Welt, die vor über 3000 Jahren pulsierte. Ihre Geschichten fließen zwischen den Zeilen – und berühren dort, wo Worte enden.
Hathor, Chons und Tutmosis – Heilerherz, Familienbande und stille Nebenrollen
Nach dem Tod von Tetitschere wird Hathor zur zweiten Frau von Mentuhotep. Mit ihrem verstorbenen ersten Mann hat sie den Jungen Chons zur Welt gebracht – ein stiller Beobachter, der später wie sein Vater und Stiefvater den angesehenen Beruf des Arztes im alten Ägypten ausübt.
Chons wächst in einem Haus voller Heilkunst, Fürsorge und innerer Stärke auf. Seine Geschichte ist leise, aber tragend – ein Erbe, das nicht in Blut, sondern in Wissen und Mitgefühl weitergegeben wird.
Auch Tutmosis, der Gatte von Setepenre – Nofretetes jüngster Tochter, die in meiner Erzählung einen ganz eigenen Part spielt – findet in diesem familiären Gefüge seinen Platz. Er ist kein lauter Held, sondern ein stiller Mitspieler im Hintergrund eines vielschichtigen Bildes, das sich aus Liebe, Verlust und Verbundenheit zusammensetzt.
Diese Figuren sind emotionale Nebenrollen, die das große Ganze mit Leben füllen. Sie zeigen, dass Geschichte nicht nur von Königen und Göttern geschrieben wird – sondern auch von jenen, die im Schatten wirken und dennoch das Herz der Erzählung tragen.
Umira, Anat, Bak und Maket – die stillen Säulen hinter den Großen
Ohne sie würde die Geschichte nicht funktionieren: Die guten Seelen im Hintergrund, die vertrauten Mägde, die treuen Diener – sie tragen das Unsichtbare, das die Welt zusammenhält.
Umira, ursprünglich aus Chatti, erlebt Migration und Integration hautnah. Mit Fleiß, Anstand und einer Prise Glück arbeitet sie sich in eine angesehene Position hoch – ein stilles Beispiel für Stärke jenseits von Herkunft und Status.
Anat ist von Kindheit an mit Königin Anchesenamun aufgewachsen. Als Kammerdienerin und engste Vertraute steht sie der jungen Königin näher als jede andere – beinahe wie eine Freundin, sähe man einmal von der gesellschaftlichen Ordnung ab. Schließlich soll der Tempel im Dorf bleiben.
Bak, der Knecht Tutanchamuns, erträgt die Launen seines Herrn mit stoischer Gelassenheit. Er ist stets da, hält ihm den Rücken frei – und läßt sich nur ein einziges Mal täuschen, als er glaubt, was sein König ihm weismacht. Seine Loyalität ist leise, aber unerschütterlich.
Maket, die alte Heilerin, steht Nofretete zur Seite – besonders bei Fragen der Familienplanung. Ihre Weisheit wurzelt tief, ihr Blick reicht weiter als der Hof, und ihre Hände kennen die Sprache des Lebens.
Diese fiktiven Nebenfiguren sind keine Randnotizen. Sie sind das atmende Fundament meiner Geschichten – emotional, glaubwürdig und unvergessen.
Maat-Ka-Re, Meriamun, Meri und Tia – eine Frau auf dem Thron
In meiner kurzen Rahmenhandlung stehen vier erfundene Figuren im Mittelpunkt – und ich habe bewusst einer Frau den Vorzug gegeben: Maat-Ka-Re ist die Erbin des Hauses und übernimmt das Amt des Pharao. Eine Entscheidung, die historisch nur in Ausnahmefällen Frauen zugestanden wurde – und gerade deshalb umso kraftvoller wirkt.
Ihr Gatte Meriamun wird Vizekönig und Großwesir – ein Mann mit Weitblick, der seine Frau nicht überstrahlt, sondern stützt. Gemeinsam führen sie das Reich mit Würde und Verstand.
Ihre beiden Kinder sind historische Persönlichkeiten, doch wer sie sind, bleibt an dieser Stelle verborgen – denn ihre Identität zu enthüllen, würde zu viel verraten. Die Spannung bleibt gewahrt.
Im Hintergrund des Bildes, das diese Szene begleitet, erhebt sich das Thebanische Westgebirge, fotografiert von Kom el-Hettan aus – dem Ort, an dem sich der Totentempel Amenhotep III. einst majestätisch erhob. Eine Kulisse, die Geschichte atmet und die fiktionale Handlung mit realer Tiefe durchdringt.
Month und Seneb – Streiche, Segel und der Nordwind
Imachyt, der altägyptische Begriff für den Nordwind, prägt das Leben im Niltal – und auch die Geschichten meiner Figuren.
Month, Meris bester Freund, gehört zu jener Bande junger Burschen, die nichts als Streiche im Kopf haben – genau wie Tut, Ahmose, Sethos und Chons. Ihre Abenteuer sind wild, witzig und voller Herz – ein Kontrast zu den ernsten Geschicken der Großen.
Months Vater Seneb trägt hingegen einen ehrwürdigen Titel: Er übernahm einst von seinem eigenen Vater Tutmosis den prestigeträchtigen Posten des Imi ra Ahau uwer em per Nesu – des Großen Flottenkommandanten des Königshauses.
In der Geschichte sorgen Month und Seneb für einen flotten Szenenwechsel: Über den Nil gleiten sie mit prächtigen Barken, angetrieben von Imachyts wohltuender Brise, die sich sanft in die Segel schmiegt und den glitzernden Wellen ihre Richtung weist.
Sie sind die lebendige Bewegung zwischen den Kapiteln – das Lachen, das durch die Paläste weht, und der Wind, der die Handlung trägt.
Sämtliche Museumsaufnahmen, Landschaftsbilder und Einblicke in Tutanchamuns Grab sind entweder von mir fotografiert oder mit dem Daz-Studio kunstvoll rekonstruiert. Die bewegten GIFs entstanden mit Unterstützung künstlicher Intelligenz –
als digitale Erweiterung meiner Erzählwelt.
















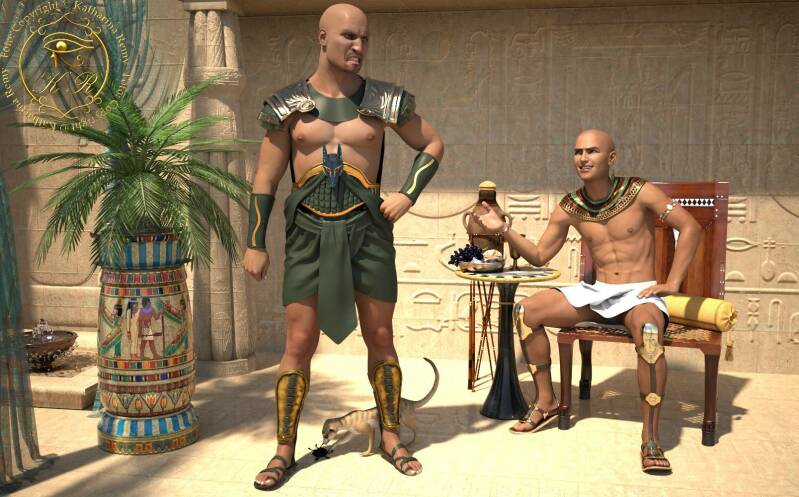










Kommentar hinzufügen
Kommentare